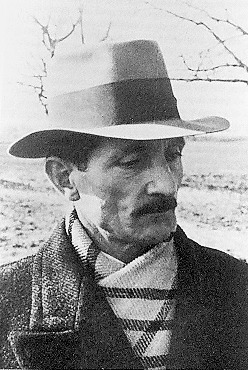Medien: Gelesen (Bücher 3)

Gelesen:
Axel Hacke
Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig
uns der Ernst des Lebens sein sollte
(Fortsetzung)
"Was für ein kluges Buch!", titelt ein Leser in den Echo-Spalten. Und dann: "Ich bin begeistert von dem unglaublich grossen Fundus an Facetten aus allen Bereichen des Wissens, die Axel Hacke in seinem Buch ausbreitet und damit einen weiten Bogen spannt rund um das Thema Heiterkeit. Triviales findet seinen Platz ebenso wie Literarisches, Philosophisches und Psychologisches. Immer schon gab es harte oder herausfordernde Zeiten, und immer gab und gibt es Geschichten, die auch in diesen Zeiten Hoffnung geben." Dem kann ich nach der Lektüre nur zustimmen. Eines ist das Buch nicht: heiter. Da liegt der: Die Heiterkeit.

Muss ein Buch über Heiterkeit auch heiter sein? Der Verlag hat diese knifflige Frage optisch gelöst. Der nachdenkliche, aber heiter dreinschauende Autor (siehe rechts) neben dem
komplizierten, heraus-fordernden Buchtitel. Woran liegt es, dass der Inhalt bei vielen Leserinnen und Leser so gut ankommt? "Dieses sehr persönliche Sachbuch beleuchtet die Heiterkeit und
ihre Verwandten aus wechselnden Blickwinkeln, was mich oft zwischen den Zeilen verweilen und zurückkehren lässt." Verweilen, zurückkehren, nachdenken... Dies alles habe ich beim Lesen auch
erlebt. Und trotzdem bin ich am Schluss vollgestopft mit Wissen, vielleicht sogar mit Erkenntnis. Aber es fehlt mir die Stimmung, das hilfreich leichte, tröstende, relativierende Gefühl,
mit dem das Schwere zu überwinden ist. Da genügen ernste, und interessante Ausführungen, und zwar in einer prägnanten Sprache, trotzdem nicht. Der Erzähler «stottert» sich durch die Vielfalt der
Kapitel, in denen fast alles zum Thema Humor aufgegriffen und dargelegt wird. Allein, mir fehlt der Humor.

Gelesen:
Christian Haller
Sich lichtende Nebel
Novelle
(Fortsetzung)
Auch wer den Klappentext und die Würdigung des Werks (Schweizer Buchpreis) vorgängig nicht gelesen hat, begreift rasch: Es geht um den deutschen Physiker Werner Karl Heisenberg (1901-1976), den Begründer der Quantenmechanik. Hätte ich dies realisiert, bevor ich das Buch gekauft habe, hätte ich es wohl nie gelesen. Es war der Buchpreis (2023), der mich angestachelt hat, doch einmal Christian Hallers literarisches Schaffen nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern mich hineinzuwagen.

Dieses Mal in eine Welt, des "Sich lichtenden Nebels", in der es um Wahrnehmung und ihre «Unschärfen» geht, um eine Begegnung zweier Menschen, die sich nie begegnet sind. Es ist der junge Wissenschaftler (Heisenberg), der «Beobachter», wie er im Buch bezeichnet wird, der sich beruflich immer mehr in der Theorie der Quanten und Atome «verliert» und vom Heuschnupfen geplagt, Halt und Hilfe in der Erholung, in der Natur (Helgoland) sucht. Sein Gegenspieler ist der alte, emeritierte Historiker Helstedt, der sonderbare Visionen hat, in denen Fantasie zu Realität wird, die er festhalten möchte, in Worten das Undefinierbare schildern. Geschildert wird dies alles in einer Sprache, schnörkellos, präzise - trotzdem aber schön, poetisch, ja sogar romantisch. Der letzte Hauch von Staub, der sich einst in viele Novellen gesetzt hat, ist weggewischt. Und trotzdem lichtet sich nicht einfach nur der Nebel, wird behutsam zu Einsichten gelenkt. Das Wahrnehmen geschieht innerlich, nicht bloss in der klaren Sicht, vielmehr in der Akzeptanz des Nicht.sehen-könnens, n der Wahrnehmung des Erlebens.

Zwei Spaziergänge sind Ausgangspunkt für eine Geschichte, die sich beinahe unabhängig voneinander entwickelt und doch - erzählerisch - fast schon verwirrend - ineinander verwoben ist. Dazu Roman Bucheli (NZZ): "Wo Heisenberg in der Unschärfe den Kern seiner Theorie erkennt, verliert sich Helstedt zunehmend in den Ungewissheiten seiner Wahrnehmungen und Denkwege. Auch er macht eine mystische Erfahrung. Es ist ihm, als sehe er ins Innere der Materie, nur dass ihm die Sprache fehlt, seine Wahrnehmungen angemessen darzustellen. Er wird selber Teil dessen, was er beobachtet, die Unschärfe greift auf ihn über."


erlöschen ist. In diesem Fall: die Liebe zu einer Welt, die halb fiktiv, halb real ist, zu einer unterhaltsamen und charmanten Lektüre, erdacht von einem schottischen Bon Viveur, der im Süden
Frankreichs eine zweite Heimat gefunden hat: Martin Walker, alias Bruno, inmitten einer stattlichen Schar von Freundinnen und Freunden, in einer Landschaft, in der scheinbar immer die Sonne
scheint. Doch dieses Mal ist es, als hätte der Autor geahnt, dass dieses wohlige Weltbild nicht mehr so ganz aufgeht, wenn er als Nach-Nachwort Voltaire zitiert: "Jede Art zu schreiben ist
erlaubt - nur die langweilige nicht."
Da liegt das Problem bei diesem «sechzehnten Ausritt» Brunos in die grosse Welt des Verbrechens, des Verrats, der Geheimdienste und Kriege. Sie finden zwar weiterhin ausschliesslich in der
kleinen, ländlichen Welt von Périgord (östlich von Bordeaux) statt,

begleitet von einem immer grösser werdenden Kreis von "Personal", das aber nie so richtig in Geschehen eingreifen kann. Damit wird das Gleichgewicht zwischen Spannung und Idylle, zwischen Scharfsinn und Naivität, zwischen Ernst und Spass empfindlich gestört. Auch wenn der geschichtliche Hintergrund - wie immer beim erzählenden Historiker Walker - sowohl aktuell und als auch präzis und interessant ist, kommt immer wieder Langeweile auf. Zu viel wird erklärt, zu wenig erlebt, zu wenig wird der Leser, die Leserin in die Stimmung geschaukelt, die bisher die Bruno-Krimis so speziell und erfolgreich gemacht haben.
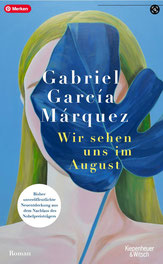
14. Mai 2024
Gabriel Garcia M
aus dem Spanischen von Dagmar Ploetz
2024, Kiepenheuer & Witsch
141 Seite, NSBN 978-3-462-00642-1
(Fortsetzung)
Ein Episodenroman. Nein, kein Roman, bestenfalls Fragmente eines Romans. Geschichten. Eigentlich eine Geschichte, erzählt in sechs Episoden. Jede in sich geschlossen und doch ineinander verwoben. Zusammengehalten von einer bald fünfzigjährigen Frau, Ana Magdalena Bach, die aus einer «glücklichen Ehe» ausbricht, nur einmal jährlich, jedes Mal nur eine Nacht. Eine glückliche, eine enttäuschte, eine vertane, eine erlebte, eine eingestandene, eine verleugnete… Immer wieder kehrt sie zurück, in den harmonischen ehelichen Alltag, immer wieder im Gewohnten verändert… Es sind Kabinettstücke von ein paar wenigen Augenblicken des «verbotenen» Tuns, vulgär «Quickie» genannt, hier nicht eingekleidet, eingebettet, vielmehr «betäubt vom Schlag ihres Herzens». Márquez ganz anderes geleistet haben, Grösseres, Verbindlicheres, Ausgefeilteres. Das hat er selbst – betroffen von zunehmender Demenz – erkannt und verfügt, das Werk (im jetzigen Zustand) sei zu vernichten: unbrauchbar. Die Schar der Kritiker stimmen da ein: "Seicht, konventionell und läppisch", so das vernichtende Urteil von Volker Weidermann in «Die Zeit». Wem die Huldigung wichtiger ist, das ein Werk (auch wenn es nicht das beste ist), der mag so urteilen. Wer aber die in sich stimmige Geschichte wirklich aufnehmen und geniessen möchte, als in Sprache und Musik gekleidetes Erlebnis, das nicht irgendwo im unbedeutenden, episodischen Vergessen endet, sondern sich leicht, wie vom Zufall gefügt, in einer Aussage endet, die nicht so einfach wegzuschieben, zu vergessen ist. Ich wiederhole: ein kleines, vielleicht bescheidenes, Kabinettstück des Lebens in literarischer Form. Márquez hat es uns hinterlassen, auch wenn es nicht «vollendet» ist: Auch Literatur kann und darf «unvollendet» sein und trotzdem für Leser und Leserinnen spannend, erkenntnisbringend und genussreich sein. Offensichtlich gehöre ich zu dieser Gattung von Lesern. Peter Züllig

Jakob Schaffner
Johannes
Roman einer Jugend
Mit einem Nachwort von Peter Hamm
2005, Verlag Nagel & Kimche
Nach einer Erstausgabe von 1922
555 Seiten, ISBN 3-312-00355-5
Verfemt und Vergessen
Eigentlich wollte ich nur wissen, wie es Johannes Schattenhold, der autobiografisch geprägten Romanfigur von Jakob Schaffner (1875 – 1944) ergangen ist, nachdem der Zögling im Konfirmationsalter die Armenanstalt «Demutt» verlassen hat, «mit einer Pappschachtel in der Hand, allein und sehr von dem Gefühl seiner Kleinheit in der weiten Welt geängstigt.»

Es ist ein gutes Zeichen, wenn ein Roman – geschrieben vor gut hundert Jahren – noch immer so stark berührt, dass man wissen möchte, wie es denn weiter gegangen ist, weitergegangen wäre…
In diesem Fall ist es möglich, das Leben des Ich-Erzählers Schattenhold bis ins fiktive Alter mitzuverfolgen. Es endet – dies sei verraten – nach einer langen Jagd in der Fremde, gut bürgerlich im eigenen Haus, in der Heimat, wo auch Emilie, der geliebte Traum, eine neue Heimat gefunden hat. Es waren weitere mehr als 1500 Seiten in drei Büchern, bis es so weit war. Die Bilanz: ein fulminanter Start im ersten Buch. Die unaufgeregte Erinnerung an eine Kindheit mit viel Verlusten, Brüchen, Hoffnung, Enttäuschung und einer – aus heutiger Sicht - unvorstellbaren Zucht in einer in der pietistischen Waisenanstalt Demutt.
Und - hat es sich gelohnt? Ja! Jakob Schaffner hat an die 50 Erzählungen und Romane geschrieben. Er konnte vom Schreiben gut leben, starb 1944 in Strassburg beim Bombardement der Stadt durch die Alliierten und ist in seinem Heimatdorf Buus (BL) (unter Protest) begraben worden. Ich habe von seinem umfangreichen Werk nur diese vier Bücher gelesen. Sie dokumentieren ein beachtliches Stück «Zeitgeist» und sind – trotz zunehmend träumerischer, schwärmerischen Bespiegelung einer «neuen Epoche» - durchaus spannend und aufschlussreich.

Allerdings tauchen auch immer wieder unglaublich schöne, treffende und klar beschriebene Episoden und Beobachtungen auf, welche die Erzählkompetenz des Autors dokumentieren (Beispiele: beim «Morgenstreich» in Basel, dem psychische und physischen Zerfall und Tod seiner Mutter, der Verlorenheit in der Grossstadt Paris…) Solche literarische, erzählerische Lichtblitze gibt es auch im dritten und vierten Band des Lebensromans.
Doch diese drei Bände hat kaum mehr Leserinnen und Leser in der Schweiz gefunden. Sie erschienen 1930, 1933 und 1938, der dritte Band bereits unter nationalsozialistischer Gunst. Der einst (bis in die 20er-Jahre) erfolgreiche, gefeierte Autor, mit Riesenauflagen seiner Bücher, «agierte seit seinem Bekenntnis zur «Auferstehung des Reiches» und seinen Auftritten als Redner für die «Nationale Front»… als Anwalt einer ausländischen Macht, ja als Vertreter einer potentiellen Bürgerkriegspartei.» (Ulrich Fröschle, in «Schweizer Monat», 2006) mit seiner politischen Gesinnung.

Er hat sich in den 30er-Jahren dem Gedankengut von Hitler-Deutschland angeschlossen und ist zum literarischen Propagandisten der Nazi geworden. Für die Schweiz von damals ein unglaublicher Fehltritt, der ihm nie verziehen wurde. Auch sein Schaffen, sein Werk, hat darunter gelitten. Der zweite Band der Tetralogie (vierteilig) – 1930 erschienen – hat bereits an Kraft und Stringenz verloren, träumt sich phasenweise durch (rückblickend) durch eine Welt, wie sie gewesen war, aber zu einer Zeit, als Schaffner die Fortsetzung geschrieben hat, nur noch in der Erinnerung existierte.
Was ist bei Jakob Schaffner Nachverurteilung und was lässt sich in seinen frühen Werke (literarisch verarbeitet) finden?
Da bleibt «vieles noch zu erklären. Der Roman «Johannes» mit seinen «aufgeschlagenen Augenblicken der Seele» bietet dazu einen Schlüssel», schrieb Ulrich Fröschle, Literatur- und
Kulturdozent in Dresden.
Peter Züllig

Kim de l’Horizon
Blutbuch
2022, DuMont Buchverlag, Köln
336 Seiten, IABN 978-3-8321-8208-3
(Fortsetzung)
Es ist nicht dieser Gefühls- und Fiktions-Wirrwarr, der Klarheit im Denken und Handeln des Icherzählers (über weite Strecken des Briefschreibers) bringt, es ist vielmehr die Poesie, die Schönheit, die Klarheit, die Empfindsamkeit, mit der die Vergangenheit (über Generationen) und die unmittelbare Gegenwart (im realen Hier-und-Jetzt) ergründet, entschlüsselt und beschrieben wird. Das hat mich begeistert, auch wenn Sprache oft mehr als nur vergewaltigt wird. Da setzt eine für mich berechtigter Vorbehalt ein. Ein Verdacht, der sich nicht so leicht wegbringen lässt: Wieviel ist nur (zum Teil gekonnte) «Hascherei» nach Aufmerksamkeit. Zum Beispiel die Satzverkürzung auf sieben Worte, auch dann, wenn daraus kein grammatikalisch richtiger Satz wird.

Begründung: Demonstration der Kraft und Wirkung einer Wortverkürzter Sprache. Oder: der letzte Brief an «Grossmutter» in englischer Sprache - jetzt nennt er sie «Mutter» (Grandma), nicht «Grossmeer», wie in allen anderen Teilen des Buchs – mit der Übersetzung ins Deutsche, aber seitengedreht. Das sind Aufmerksamkeitsmätzchen (mein Kommentar: er hat wirklich nichts ausgelassen!), die dem Buch massiv an der Ernsthaftigkeit uns Glaubwürdigkeit schaden.
Es mag sein, dass «jemensch» dies nicht verstehen kann (und will) weil es nur das Ungeordnetsein (das Schweben zwischen den Geschlechtern) jener «Jemenschen» zum Ausdruck bringt, die sich non-binär fühlen. Eine interne Kommunikation zwischen einer kleinen Gruppe der Menschen. Sicher aber nicht einen literarischen Wert für ein mehrfach preisgekröntes Werk (Deutsche und Schweizer Buchpreis) uns der damit verbundenen Begründung ««Jeder Sprachversuch, von der plastischen Szene bis zum "essayartigen Memoir", entfaltet eine Dringlichkeit und literarische Innovationskraft, von der sich die Jury provozieren und begeistern liess.» Es kommt mir vor, als hätte das Buch bei den Juroren (Germanistinnen und Germanisten) – ob binär oder non-binär – ein Orgasmus ausgelöst, weil diese Art von Kommunikation (aus den Hexenkessel) jegliche Art von Ästhetik und Ethik der Sprache (mit und ohne Gott) ausklammert.

Auch literarische Kleingötter dürfen einen Orgasmus haben. Doch sie sollten – dies erwarte ich von ihnen und ihrem Beruf (und Berufung) – nicht nur loben und preisen, sondern orgasmuslos analysieren, wo ein Werk seine Stärken und seine Schwächen hat. Dann wäre das Buch ein gutes Buch, ein kreatives Buch, eingepackt in eine Theaterszenerie (der Autor kennt und arbeitet für das Theater), die über weite Strecken auch langweilig ist, weil es sich zu oft in eine Schlacht von Metaphern erschöpft. Schade für die Innovation, die ohne die prätentiösen Anwandlungen, durchaus zu (erleben) und geniessen wären. Peter Züllig

Filme für den kreativen Widerstand
Zum Wirken Karl Saurers (1943 – 2020)
Herausgegeben von Elena M. Fischli
Eine Besprechung des Buchs folgt hier sobald es gelesen ist. Zum Film "Ruhe" mehr in der Rubrik "Kunst und Kultur"

Gelesen:
Thomas Kramer
Karl May im Kreuzfeuer
2023, Evangelische Verlagsanstalt Leipzig
Taschenbuch, 162 Seiten, ISBN 978-3-374-07423-5
Zum aktuellen Thema und zum soeben erschienen Buch habe ich bereits in der Rubrik "Aufgeschnappt" auf dieser Website eine Besprechung der Leipziger Zeitung (LZ) eingestellt.
Sachbücher haben keine literarischen Ambitionen. Sie sind der Information, der Aufklärung, den Fakten verpflichtet. Thomas Kramers "Karl May im Kreuzfeuer" ist ein Sachbuch. Doch es befasst sich in der "Sache" mit umstrittener Literatur.

Karl May stand als Schriftsteller schon immer - und immer wieder - im Kreuzfeuer der Kritik. In extremis die Ansichten: von Schund bis Literatur. Im Zeitalter von "Woke" (oder "Wokeness") musste ja eine neue Welle der Ächtung kommen. Ausgelöst durch ein Buch, das - ausser dem Namen "Winnetou" - so gut wie nichts mit Karl May zu tun hat. Ausge-rechnet der "Ravensburger Verlag", der während vielen Jahren mit dem Marken-zeichen "Karl May" beste Geschäfte gemacht hat (viele Spiele), tritt nun als moralische Instanz auf: als Winkelried gegen den latenten Rassismus. Als Kronzeuge tritt Jürgen Zimmerer auf, ein deutscher Historiker und Genozidforscher auf (fast omnipräsent in allen Medien) und spricht (oh rührend) vom nostalgischen Blick auf die Kindheit: "Natürlich hatte ich den auch". Aber jetzt ist er geläutert: "Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, die Bücher von Karl May wieder zu lesen, weil ich an einem Buch dazu schreibe. Und das war eine ernüchternde Erfahrung, weil mir das genau diesen nostalgischen Blick auf mein früheres, schönes Leseerlebnis kaputtgemacht hat". Offensichtlich kann der einst jugendlich begeisterte Leser als Historiker nicht mehr ohne Alarmstimmung lesen und sieht auf Schritt und Tritt bei Karl May "die DNA des Rassismus". Hat er richtig "gelesen", der selbsternannte Literaturexperte?

Wer hier eine "verbissene" Streitschrift erwartet, ein Duellieren von zwei Wissenschaftlern, der liegt daneben. Das "Kreuzfeier" ist kein Gefecht, vielmehr eine Klarstellung von so vielem, was in
der letzten Zeit so alles gesagt und behauptet wurde. Auch vom unermüdlich sich wiederholenden "Kronzeuge" (und DNA-Schnüffler) Jürgen Zimmerer.
"Für den Genozidforscher Jürgen Zimmerer gehört die koloniale Fortschrittsideologie zur DNA von Karl May. Über die Bücher sollte man diskutieren – als historische Dokumente."
Da zeigt sich bereits der erste (grundsätzliche) Fehler in der ausser Rand und Band geratenen Diskussion um Karl May. Es sind keine "historischen Dokumente", die Karl May hinterlassen hat, es ist
Literatur (ob gute oder schlechte sei dahingestellt). Insofern sind es "historische" Dokumente in Bezug auf die Lektüre (das, was interessiert hat, in Deutschland, zum Teil in Europa, im
ausgehenden 19. Jahrhundert). Es sind spannende Märchen, die einen unglaublichen Erfolg hatten (Höchstauflagen) und immer noch haben. Warum das so ist, kann und soll (als literarische Dokumente)
durchaus diskutiert werden. Da greift das Geschwurbel um DNA (Desoxyribonukleinsäure als Träger von Erbinformationen) in den Werken von Karl May viel zu kurz, ist ungenau und in vielem
schlicht und einfach falsch.

Stimmen wenigstens die Fakten und nicht seine "Forschungsgefühle"? Dies wird im Buch von Thomas Kramer überprüft und analysiert: sachlich, fachgerecht, mit Zitaten, Vergleichen und historischer Einbettung in die populäre Literatur des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Da ist soviel reine Behauptung, Geschwurbel und Halbwahrheit beim Historiker Zimmerer auszumachen, dass auch er - nicht ganz unverschuldet - einen Shitstorm erleben musste und sich - schwups - zum Opfer erklärte: "Eine Gesellschaft, in der man Autoren nicht mehr kritisieren darf, ist eine illiberale (man könnte weniger "professoral" auch sagen: keine liberale) Gesellschaft. Man muss sagen dürfen: Das ist ein Kolonialist, das ist ein rassistischer Autor." Man muss dürfen! Aber es muss - auch ansatzweise - richtig sein, besonders, wenn man sich als professorale Instanz inszeniert.

Zwar muss selbst Jürgen Zimmerer eingestehen: "...es wirklich erstaunlich, dass er (Karl May) Ende des 19. Jahrhunderts von Völkermord an den Indianern spricht, das ist
hellsichtig... er pflanzt mit seinen Geschichten die Idee in die kollektive Mentalität ein, dass es mehr oder weniger »normal« ist, dass Völker einfach »untergehen« oder gar vernichtet
werden!" Letzteres ist eine Pauschalisierung und Behauptung, die für einen Wissenschaftler ohne Beweise und Beispiele untragbar ist. Dieser Oberflächlichkeit und Verzerrung tritt Thomas
Kramer in seinem Buch entgegen. Erfolgreich und durchaus wissenschaftlich. Und stellt viele (zum Teil unbedarfte Aussagen (nicht alle) der Generalkritiker in die Ecke eines selbstverliebten
Zeitgeistes, der den realen Kolonialismus (und seine Folgen, die zum grossen Teil heute noch nicht aufgearbeitet sind) in den Rahmen einer künstlichen Aufgeregtheit (Woke), die weder Probleme
löst, noch das Bewusstsein (für soziale Ungerechtigkeit) stärkt. Im Gegenteil: historisches Unrecht in Floskeln erstickt.

Thomas Kramer geht der Sache in rund 30 Kapiteln auf den Grund. Mit Zitaten, mit Beispielen, mit Einbettung in die Zeit und Kultur (vor mehr als 100 Jahren, als die diskriminierten Texte entstanden). Er macht dies unaufgeregt, trotz der Polemik in vielen Angriffen und Behauptungen der "Ankläger" sachlich und sachgerecht. Er zeichnet das nach, was der Vielschreiber Karl May geschaffen hat: Literatur. Texte, die gelesen wurden, die immer wieder (in vielen medialen Formen) auftauchten und weitergetragen wurden. Sicher, sie enthalten - aus der Sicht des Historikers - auch Irrtümer, Fehleinschätzungen, Ungenauigkeiten. Sie stammen eben aus einer Zeit, die ihren eigenen "Zeitgeist" hatten, eine andere gesellschaftliche und politische Realität.

Gelesen:
Peter Stamm
Archiv der Gefühle
Roman
2021, Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main, 192 Seiten,
ISBN 978-3-10-397402-7
Wie so oft bei Peter Stamm (*1963) wird auch hier nicht eine Geschichte einfach nur erzählt, geschildert, dramatisiert, er lässt sie entfalten, langsam, sogar gemächlich, aber unglaublich stimmig. Dafür braucht er keine abgenutzten Adjektive, keine gesuchten Analogien und keine Sprache, die sich in Nebensätzen ergiesst. Es ist die Sprache, die herrscht, beherrscht, aber ganz in den Hintergrund tritt, weil sie nicht versucht Gefühle zu schaffen, sondern sich eher hinter ihnen verbirgt, als gehöre sie selbstverständlich dazu, als wäre sie mit dem Gefühl auch da. Ich liebe diese Sprache, diese Knappheit, die den oft unerfindlichen Weg der Gefühle zulässt, nicht bewertet und schon gar nicht abwertet.

Der Held der Geschichte ist alles andere als ein Held, eher ein Pantoffelheld, der sich hinter die möglichst präzise, faktenbelegte Erinnerung duckt, hinter die Dokumente und Fakten, die seine Arbeit prägen. Aber erst, nachdem sie sorgfältig ausgewählt, geordnet, systematisiert, katalogisiert und abgelegt sind. Abgelegt, nach einem Ordnungsmuster, das verbindlich ist für alle funktionierenden Archive.Eine Katastrophe für den buchhalterisch denkenden und arbeitenden Archivar: Er verliert seine Stelle (und damit einen wichtigen Teil seiner Existenz), weil ein neues System, namens Computer, ihn abgelöst hat. Das lässt er sich nicht einfach so bieten und installiert – bei sich zu Hause, im Keller – ein «Schattenarchiv», das weiter funktioniert wie bisher, aber nicht mehr gebraucht wird. Erst da schmuggeln sich – zuerst kaum bemerkt, erst viel später herrschend und beherrschend – Erinnerungen (Archivstücke) an Gefühlen ein. Sie lassen sich nicht mehr so einfach (nach gegebenem Ordnungsmuster) einordnen und – jederzeit griffbereit – aufbewahren. Das Leben holt das Archiv ein. Und mit dem Leben die Liebe. Liebe eher in Form von Dokumenten, die aber i

m Archiv zu wenig Raum, ja keinen Platz, haben. Der Archivar glaubt, mit dem Ausräumen und Vernichten des Archivs, sei ein Weg gefunden, um weiterzuleben. Der Autor weisst ihm sogar ein paar Wege (und Irrwege) für ein anderes Leben. Doch kann das gelingen? Lassen sich archivierte Gefühle zurückholen ins Leben? Auf 192 Seiten archivierter Sprache nicht. Vielleicht aber in dem, was Sprache auslösen kann. Wer weiss? Wer weiss?

Gelesen:
Katharina Maier
Adelsspross
Zukunftsepos „Die erste Tochter“
7teiligen Reihe. Bisher erschienen „Adelsspross“ (1), „Frevlersbrut“ (2), „Narrenbraut“ (3)
2019, Verlag «epubli», Taschenbuch, Seiten: 336, ISBN: 9783750202092
Die ersten drei Bände sind bereits erschienen. Da ich versuche, als fast schon leidenschaftlicher Leser (siehe Rubrik «Gelesen» auf dieser Website), dem Geschriebenen und Publizierten, etwas intensiver auf den Grund zu gehen, startete ich mit dem ersten Band der «Ersten Tochter», «adelsspross», der ersten Tochter. Bereits der «Klappentext» schürte eine leise Ahnung, dass es sich beim Planeten «Singis» und seinen Bewohnern, weniger um eine andere Planetenwelt handelt, eher um eine Übersetzungsarbeit von weltlichen Begriffen, Problemen, Strukturen… in eine andere Welt.

Zwar erhalten einige Begriffe neue Namen und Dimensionen. Zum Beispiel die Zeiteinheit Mnega (Mehrzahl: Mengau) oder die Reittiere Tygdulai (Einzahl: Tygdul), die an die Zuchthengste «Rih» und «Hatatitla» von Karl May erinnern. Einiges – vor allem Namen – sind für uns kaum aussprechbar und/oder erinnerbar. Sonst aber – das zeigte sich beim Lesen – ist das Denken und Handeln sehr irdisch, jedenfalls nicht allzu entrückt in andere Denkwelten. Da gibt es Mütter und Schwiegermütter, Hausangestellte und Priester, Künstler und Lehrer… und vor allem Probleme, wie wir ihnen auch auf unserem Planeten begegnen, inklusive Heimtücke, Verschlagenheit, Verleum-dung. Nur eine Liebesszene – eigentlich eine Kussszene (Seite 207) - war gar nicht irdisch, eher technisch - jedenfalls so beschrieben, als dem «Nebenhelden» «bestes Mittel gegen eine eingehende Introspektion» bis dato untergekommen war."
Ich will und kann kein Urteil über das Denken und Schreiben dieses geplanten umfangreichen Werks fällen. Dafür ist der erste (und einzige) gelesene Band zu wenig aussagekräftig, zu wenig in eine anderen Welt verzogen. Eines aber ist mir geblieben: Das Lesen glich sprachlich einer Fahrt über eine «Buckelpiste». Unendlich lange, dann ganz kurze Sätze, Adjektive, die nur so durch das Buch purzeln und immer wieder Fallhöhen, die für die einen Spass sind, für andere - zum Beispiel für mich - ein Ärgernis. Jedoch die Hoffnung aufkommen lassen – dass nach (geschätzten) weiteren 2000 Seiten - schon noch alles gut wird, auf dem Planeten «Singis», der so sehr unserer Erde gleicht.
Peter Züllig

Gelesen:
Martin Walker
Troubadour
2023, Diogenes-Verlag, Zürich
400 Seiten, ISBN 978-3-257-07237-2
Aus dem Englischen von Michael Windgassen
Es begann vor fünfzehn Jahren. Bruno Courrèges trat an zum ersten Fall. Die Geschichte: Ein Rückkehrer aus der einstigen französischen Kolonie Algerien wird im Städtchen Saint Denis (Périgord) tot aufgefunden.

Der Dorfpolizist ermittelt, weitgehend auf eigene Faust. Denn «grosse Fälle» sind nicht Sache des kleinen Beamten in der Provinz. Da muss schon die nationale Sicherheitspolizei her. Doch Bruno, der begehrte Junggeselle, der die Kinder über die gefährliche Dorf-Strasse leitet, löst den Fall und schafft damit die Grundlage für eine vergnügliche Krimi-Serie, die rasch zum Kult geworden ist. Ein Urteil von damals: «Kein Krimi, eher eine Einstimmung für den nächsten Urlaub in Frankreich» (buechertreff.de). So ganz daneben ist diese Bemerkung nicht. Tatsächlich ist die Bruno-Reihe eine geschickte Verknüpfung von Aufklärung (historisch bedeutender Ereignisse und Fakten), Schilderung von ländlichem französischen «savoir vivre» - besser «l’art de vivre» (Lebenskunst) – und fast schon kultischem Glauben an Freundschaft und Gemeinschaft.

Das ist nach 15 Jahren nicht anders. Vielleicht sogar noch ausgeprägter. Die Handlungen, immer eingebettet in ein historisches Umfeld, sind differenzierter, lebens- oder blutnaher geworden, die Fäden versponnener, durch die Charakterisierung der immer wiederkehrenden Figuren auch verständlicher und glaubwürdiger. Auch die Schwächen sind die gleichen geblieben: da wird zwar gelebt, aber nicht gealtert. Der attraktive Junggeselle bleibt der attraktive Junggeselle, die grosse Liebe bleibt die grosse Liebe und der gut vernetzte Bürgermeister bleibt der gutvernetzte Bürgermeistert. Nur die Themen haben sich – fast unbemerkt – leicht verschoben. Die «Grünen» und ihre Sicht der Welt sind nicht mehr Gegenstand des leisen Spotts, «Foie gras», die Gänseleber, fast ganz verschwunden und das gute Essen (samt seiner Zubereitung) und den begleitenden Weinen nehmen noch mehr Raum ein.

Sogar der unglaublich geschäftige Bruno kann in der gleichen Zeit noch viel mehr erledigen: den Markt besichtigen, ausreiten, Kinder begleiten, telefonieren, telefonieren, den aufsässigen Lokalreporter in Schach halten, «Balzac», seinen Basket-Hund pflegen, Kinder einer Freundin trösten, recherchieren (hier und dort und hier), die Kinder in das Spielen (Tennis- und Rugby) einführen, kochen, den Garten pflegen und erst noch verzwickten Fälle lösen (oder mindestens einer Lösung näherbringen). So viel vermag auch der beste Bruno der Welt, in ein paar Stunden, Tagen, in einer Woche nicht zu leisten. Das ist weit mehr als die 1000 Wörter, die der Autor Martin Walker (nach eigener Aussage) an einem Tag schreiben kann.

Wie so viele Bruno-Fans habe ich alle bisherigen 15 Bände gelesen (und einige der Kurzgeschichten und Begleitbücher dazu). Anfänglich mit grosser Begeisterung, vor allem wegen der Beschreibung
der Landschaft, der Gegend, seiner Kultur. Ich war sogar an Tatorten der fiktionalen Geschichten, in der fiktiv-realen Bruno-Welt. Ich habe Weingüter besucht, Essen und Trinken «überprüft» (sogar
«nachgessen» und -getrunken), Örtlichkeiten nach realen Spuren der Fantasie des Autors abgeklopft. Ich bin dankbar, dass am Schluss eines jeden «Falls» (in einer «Danksagung») Fiktion und
Realität getrennt und die historisch politischen «Hintergründe» kurz erläutert werden. Es sind vor allem die Schöpfungen von Figuren die leben, denken und fühlen, in einer Welt, in der man über
weite Strecken – allen Verbrechen zum Trotz – leben möchte. Es ist das Menschliche im Sachlichen, es sind die Gefühle in den erfundenen und nachgezeichneten Fakten, welche die Krimi-Reihe zum
Gewinn, zum Vergnügen und zum Kult werden lassen
Peter Züllig

Gelesen:
Arno Geiger
Das glückliche Geheimnis
2023, Hanser Verlag, München
237 Seiten, ISBN 978-3-446-27617-8
Arno Geiger ist in der Rückschau auf eine unruhige Phase seines Lebens - beim Durchblättern einer Korrespondenz - ein einziger Satz aufgefallen, der ihm gefällt: „Jetzt war ich gerade beim Frisör, und alles ist sehr still.“ Banal, nichtssagend, gar nicht Literatur-würdig. Oder doch? Vielleicht sogar so gut, um in ein Poesie-album aufgenommen zu werden. Der sprachliche Alltag ist es, der über die Sprache hinausgeht, hinauswirkt, in die Stille, in die Besinnung. Es ist ein Buch, das sich um ein „glückliches Geheimnis“ dreht. Sein Geständnis, er müsse einer seiner Liebschaften ein Geheimnis erzählen (auf Seite 85 des Buchs, für die Leserschaft ist es da längst kein Geheim-nis mehr) könnte auch das Ende der Geschichte sein. Denn ein Geheimnis ist nur so lange ein Geheimnis, bis es gelüftet wird (wörtlich: sich in Luft auf-löst). Ein Buch, das seinen eigenen Inhalt schon auf den ersten Seiten, verrät, aufgibt, vernichtet, hat es schwer gelesen und aufgenommen zu werden. Doch der Autor schafft es, wenigstens über weite Strecken, das Geheimnis - sein Geheimnis - zu hinterfragen.

(Fortsetzung)
"Wenn sie das Wort Geheimnis höre", erzählt Geiger, "denke sie" ("O", eine mexikanische Malerin, mit der Autor einst ein Verhältnis hatte) "an dunkle Geheimnisse, nicht an glückliche Geheimnisse. Eine Professorin … habe einmal gesagt, jeder Mensch hat ein Geheimnis, wer keines habe, sei so gut wie tot. Dann lieber ein glückliches Geheimnis…“
Um ein „glückliches Geheimnis“ geht es in diesem Buch, um ein Geheimnis, das kein Geheimnis mehr ist. Aufklärung kann es deshalb nicht sein, bestenfalls Spuren-suche. Die Spur vor und nach einem gelüfteten Geheimnis. Es ist eine Kriechspur, keine schleimige - vielmehr eine poetische - die immer wieder Erfolge und Misserfolge, Angst und Freude, Glück und Trennung (und noch einiges mehr) miteinander verbindet und verknüpft. Dabei geht es - im Kern - um Lesen und Schreiben, Sammeln und Wegwerfen, Warten und Fliehen. Nie aufgeregt, selbst in turbulenten Zeiten. Nie hektisch, doch mit viel Selbstironie und einem klaren Blick (Rückblick) auf das eigene Leben. Irgendwann – nach vielen Rückschlägen – ist dann der Erfolg doch gekommen, haben sich Geduld und Hartnäckigkeit ausbezahlt, in Geld und Anerkennung.
Dass bei der leisen Kritik, die latent mitschwingt, auch der Verlag, der tradierte Kulturbetrieb, die Literatur- und Buchkritik ihren
Teil abbekommen, ist nicht erstaunlich. Dabei wird das Geheimnis, das kein Geheimnis mehr ist, überwunden und zurückgelassen. Doch es tauchen immer mehr Fragmente auf, aus den Spuren
des
Denkens und Schreibens des Schriftstellers, welche den Leserinnen und Leser seiner früheren Bücher («Kleine Schule des Karussellfahrens», «Irrlichterloh», «Schöne
Freunde», «Es geht uns gut», «Anna nicht vergessen», «Alles über Sally», «Der alte König in seinem Exil», «Selbstporträt mit Flusspferd», «Unter der Drachenwand»)

manche Fragen und Zusammenhänge sichtbar machen, klären. Also doch ein "aufklärerisches" Buch? Ja, denn alle Figuren und Ereignisse, Enttäuschungen und
Hoffnungen - in Sprache gestaltet und modelliert - haben ihre Wurzeln beim Schriftsteller, in seinem Leben, in seinem Denken und Handeln. So kann aus Fantasie und Poesie gute – vielleicht sogar
grossartige – Literatur werden. Und das "schöne Geheimnis"? Es hat sich klammheimlich weggeschlichen, aufgelöst. Wie Arno Geiger sagt: "... in Geschriebenes, das dasteht, ein bisschen rau,
stellenweise ungehobelt als Ausdruck meiner selbst."
Peter Züllig
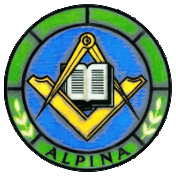
Gelesen:
Gion Mathias Cavelty
Lucifer
Roman
2022, Lectorbooks, Zürich. 173 Seiten,
ISBN 978-906913-36-0
Durch das neuste Buch des Bündners Gion Mathias Cavelty habe ich mich durchgehangelt, nur weil ich eindringlich gewarnt wurde. Cavelty sagte einmal, dass er «das schlechteste Buch aller Zeiten» schreiben wolle. Das ist ihm gelungen, meinte der Literaturkritiker Cornelius Wüllenkemper im Deutschlandfunk. Dabei klingen bei mir die Worte meines Vaters in den Ohren, über einem Autor, mit dem ich einst in die Welt der Bücher eingestiegen, wie eine deutliche Warnung und vernichtende Kritik.

Wie damals habe ich mich auch jetzt – dreiviertel Jahrhundert später – dem gutgemeinten Rat widersetzt und eine neue Version des «schlechtesten Buchs aller Zeiten» zur Hand genommen. Anderer Autor, anderes Buch, anderer Inhalt. Und wieder war die Erfahrung eine ganz andere, eine neue.Das neuste «schlechteste Buch» ist nicht so spannend wie das von damals, auch nicht so einfach zu verstehen und schon gar nicht so einfach zu deuten. Auch musste ich am Schluss nicht weinen (wie nach Winnetou 3); ich bin auch nicht mehr der kleine Bub von einst, inzwischen durchaus lese gewohnt und weit weniger wort- und buchstabengläubig. Es ist auch nicht mehr so einfach, Helden und Überhelden aufzubauen, reale und fiktionale Welten zu entwerfen und in Geheimnisse von allem und jedem einzudringen, damit sich das Lesen (immerhin eine zeitaufwändige Beschäftigung) lohnt. Und – hat sich es sich gelohnt, «Nogg» zu begleiten, dem Sucher nach Licht, der auch der Dunkelheit – dem gefallenen Engel – begegnet? «Nogg» zu begleiten durch Jahrhunderte, die sich nicht artig aneinanderreihen, sondern wild durcheinander wirbeln; durch Kulturen, die sich produzieren und verstecken, durch Sinnsprüche, Überlieferungen und Nonsens, von Chur über Jerusalem bis nach Amerika?

Vielleicht hätte ich das Buch trotzdem nicht gelesen und dann wohl erst noch schlechter verdaut, hätte nicht die Moderatorin der Sendung «Literaturclub» (SRF) mehrmals verzweifelt die Frage gestellt: «Um was geht es eigentlich in diesem Buch?» Eine brauchbare Antwort erhielt sie nicht, auch nicht von Linard Badrill (Geschichtenerzähler und Liedermacher), der den Roman «Lucifer» in die Sendung gebracht und vorgestellt hat. Deshalb nochmals die Frage: «Wem kann man dieses Buch ans Herz legen, welcher Leserin, welchem Leser?» Die Antwort: «Dieses Buch kann lesen, wer Lust hat Fünfviertelstunden beim Lesen irritiert zu werden, denn Irritation ist der Anfang des Lernens», so Badrill, «um dann beim dritten Mal des Lesens die Erleuchtung zu finden».

Ich gebe zu, die Erleuchtung habe ich nicht gefunden (das Buch auch nicht dreimal gelesen), aber doch Anstoss erhalten, um zu erkennen, vielleicht auch nur zu erahnen, wie Welt auch funktioniert. Zum Beispiel in Geheimbünden, Männergesellschaften, in einer schwer verständlich gewordenen technischen Welt, in den Blasen von Gleichgesinnten, von symbolgetränkter Verheissung und ferner Hoffnung. In den Traditionen und Deutungen von Welt. Kommt dazu, dass die Wandlung vom «tumben Tor» (vom «Nogg» zum «Ard», edlen Ritter amüsant, sogar spannend und vielleicht doch ein ganz klein wenig erhellend ist (bis auf die Aufzählungen, die oft jeder Dramaturgie entgleiten).

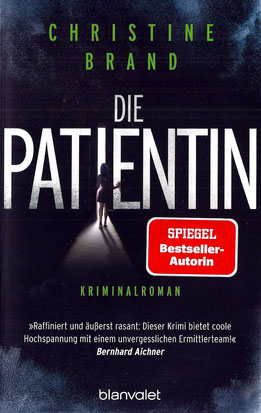
2021, Blanvalet, Penguin Random House, München, 3. Auflage (Erst-veröffentlichung 2020) Taschenbuch, 476 Seiten, ISBN 978-3-7341-1047-4
Vor zwei Jahren war ihr Debüt als Kriminalroman-Autorin, jetzt ist bereits ihr viertes Buch von der Reihe auf dem Markt. Das zweite Werk erschien noch im selben Jahr wie das erste, das vierte in
diesem Jahr ("Der Unbekannte", April 2022).
"Die Patientin" ist quasi die Fortsetzung von "Blind", ihren Erstling, den ich bereits hier besprochen
habe. Der "Zweitling" ist häufig (fast immer) eine grosse Heraus-forderung, für die Autorin, den Autor, aber auch für die Leser. Noch bevor man zu lesen beginnt, stellen sich Fragen: "Kann die
Spannung gehalten werden?" Oder: "Werden die Erwartungen, die der Vorgänge beim Lesen (bewusst oder un-bewusst) geschaffen hat, auch befriedigt. Kommt dazu eine fast schon programmierte
Unsicherheit des Autors nach dem ersten, offensichtlich geglückten Wurf. Hier weiterlesen
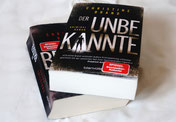
Scheherazade der Cliffhanger
Christine Brand
"Der Bruder" und
"Der Unbekannte"
Zwei Kriminalromane (Band 2 und 4 der Serie «Milla Nova recherchiert»
Verlag "blanvalet", Penguin Random House, München, 1. und 4. Auflage, 539 und 543 Seiten, Taschenbuch ISBN 978-3-7645-0745-9 und
978-3-7645-0770-1
Der Erzählstopp ist wie eine Peitsche – mitunter sogar eine schmerzliche, – mit der die Leserinnen und Leser durch eine Geschichte gejagt werden. Christina Brand kostet – in ihren bisher vier Bänden der Serie – dieses Stilmittel aus. So haben ihre letzten beiden Romane 83 und 78 (nur mit Nummern bezeichnete) Kapitel.

Ein zweites charakteristisches Stilmittel der Autorin, sind – fast so häufig angewandt wie die Cliffhanger – die Perspektivenwechsel. Das gleiche Geschehen wird – oft sogar ort- und zeitverschoben – aus der Sicht (und dem Erleben) der verschiedenen beteiligten Protagonisten erzählt. Allein schon dadurch wird – selbst auf mehr als 500 Seiten – dauernd Spannung erzeugt, ja garantiert.Eigentlich ist es etwas aus Mode gekommen, eine Erzählung im spannendsten Moment zu unterbrechen, um erst später fortzufahren. Dieses Stilmittel hat am Fernsehen und beim Radio Tradition. Da geht es darum, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Zuhörerinnen und Zuhörer (lang- und kurzfristig) bei der «Stange zu halten». In der Literatur wird mit dem Cliffhanger hauptsächlich Spannung erzeugt. Besonders wenn nahezu jedes Kapitel – es kann noch so kurz sein – mit einem Cliffhanger endet, die Auflösung aber rasch, schon zwei, drei Kapitel später, präsentiert wird. Kommt dazu, dass sich die Themen der kriminalistischen Spurensuche sehr nahe an Verbrechen orientieren, die es in der Realität (nicht irgendwo in der Ferne, im nächsten gesellschaftlichen Umfeld) gegeben hat.

Milieu nähe, wohl eine dominierende Eigenschaft ihrer Kriminalgeschichten. Dies geht so weit, dass die Fiktion gelegentlich kippt, in die Belehrung
oder Konstruktion. Alle und alles ist mit- und ineinander verhängt. Das sind peitschenden Momente, bei denen man ausrufen möchte: «Too much!» Und es, aller Spannung zum Trotz, etwas ruhiger,
sogar etwas emotional differenzierter hätte. Allein die Tatsache, dass gegen Schluss von «Der Unbekannte» oft (und sozusagen von allen) immer mal wieder geweint wird, schafft noch nicht jene
Stimmung und Atmosphäre, in der sich die Hektik der Handlung beruhigen kann. Dies wäre aber unbedingt nötig, um der gesellschaftlichen Nähe und dem Gefühl der Betroffenheit Nachhaltigkeit zu
geben.
Was mich nach der Lektüre aller vier Bände («Der Blinde», «Die Patientin», «Der Bruder», «Der Unbekannte») am meisten stört, ist die zunehmende Bändigung der Sprache, die sich oft in der Routine
verliert und nur noch selten Helvetismen zulässt. Manche Ausdrücke «verdeutscht» und sind in der Schweiz (wo der überwiegende Teil der Handlungen stattfinden), nicht beheimatet. Als Beispiel
wiederhole ich, was ich schon nach der ersten Geschichte (Der Blinde) angemerkt haben, die Formulierung: «die Tram». In der ganzen Schweiz fährt nur «das Tram», auch in Bern, und Zürich.

Man meint zu spüren, wie ein auf Kriminalgeschichten spezialisierter deutscher Verlag, seine Routine und seine Kenntnisse deutscher Leser-Erwartungen in die Geschichten einfliessen lässt. Geschichten, die sich (fast ausschliesslich) im geografischen Bereich von Bern-Zürich (100 Kilometer) studieren lassen. Einiges der anfänglichen Unbekümmertheit und Direktheit einer Journalistin, die ausschliesslich für Schweizer-Medien gearbeitet hat, geht verloren. Die «neudeutschen» Begriffe – ausgerichtet auf eine jüngere Leserschaft – nehmen zu. Das Schweizer-Milieu entfremdet sich. So manche Wortwahl und Wortspiele wirken auf- oder hineingesetzt. Die vier dicken «Taschenbücher», mit den zum Teil opulenten Fällen (auf mehr als 2'000 Seiten), sind kaum ein Format für eine Generation, die grossmehrheitlich mit dem Computer und Smartphone unterwegs ist. Da ist "Scheherazade" gefragt (die Erzählerin aus «Tausend und eine Nacht»), die dem König (der sie töten will) jede Nacht eine Geschichte erzählt, deren Handlung am nächsten Morgen unterbrochen wird, sodass der König auf das Ende der Geschichte so neugierig ist, dass er die Erzählerin am Leben lässt. Ob dies im Zeitalter der kurzatmigen

Informationsflut noch immer funktioniert? Jedenfalls prangt auf jedem Band eine rote Etikette: «Bestseller-Autorin» und die «Kriminalschinken» werden (fast schon in atemberaubendem Tempo) aufgelegt. Es muss beim Stil und Inhalt doch eben tüchtig «funzen» (EDV-Umgangssprache).
NB. Als Leser der alten Generation warte ich ungeduldig auf den nächsten, den fünften Band, der Ende April
erscheinen wird.
Peter Züllig
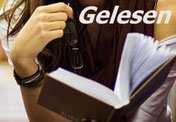
Romane, die ein historisches Ereignis oder eine Zeitepoche beleuchten, zählen nicht zu meinen «Lieblingslektüren». Vor allem dann nicht, wenn sie sich akribisch an Vorbilder, Fakten oder Bilder
orientieren. Da bleibt meist (zu) wenig Raum für eigene Kreativität in der Vorstellungswelt des Autors, der Autorin. Und ist auch ein (zu) enges Korsett für den Leser, die Leserin.

Was ist Beschreibung und Fantasie, der Romanstruktur geschuldet? Und was ist neu formuliertes Abbild einer Wirklichkeit? Ich liebe das Original, auch wenn es nicht mehr erhalten, nicht mehr zugänglich oder nur schlecht dokumentiert ist. In diesem Fall ist alles anders. Die Lebensgeschichte der Brüder Jules und Edmond de Concourt wurde – zumindest in der entscheidenden Phase – minutiös festgehalten, in einem Tagebuch, das die beiden fast symbiotisch lebenden, denkenden und handelnden Brüder hinterlassen haben, vorerst gedacht und geschrieben nicht für die Öffentlichkeit. (Später wurden dann Teile davon veröffentlicht). Für die Öffentlichkeit gedacht, war hingegen ein anderes Zeugnis, die (wahre) Geschichte der Magd Rose Malingre, erzählt von den Brüdern De Concourt, im Roman «Germinie Lacerteux», erschienen 1865. Literaturhistorisch noch heute interessant, weil das Buch – vor allem das Vorwort – gleichsam als Start zur Epoche des «Naturalismus» in Frankreich definiert wird.

Der Schweizer Schriftsteller Alain Claude Sulzer (*1963) hat – auf Grund dieser beiden authentischen Quellen - im Roman «Doppelleben» (2022) zwei GeschichtenDie Geschichte des frühen Todes von Jules de Concourt, der 1870 an den Folgen von Syphilis – nach langem Leiden – sterben musste. Daraus entstand etwas Neues, eine historisch belegte Geschichte in Form eines Sittengemäldes, das die Zeit des «Zweiten Kaiserreichs» (1852–1870) anhand von zwei «Leidensgeschichten» aufgreift. Individuelle Lebensgeschichten, dicht beieinander, in einer schichtmässig getrennten, im Alltag aber verbundenen Gemeinschaft, ohne dass davon (zu Lebzeiten der Protagonisten) Notiz genommen wurde.

Die Bedienende und die Bedienten lebten viele Jahre zusammen, gleichsam in einer gottgegebenen Ordnung, in der es nur eine Welt gab,die eigene. Erst der Tod machte das «Doppelleben» - inseiner ganzen Tragweite sichtbar. Da wird auch das nachgeschriebene, «nachgedichtete» Buch zum grossartigen Werk, das berührt und – ich kann es nicht anders sagen – «unter die Haut geht». Noch nie habe ich Leid und Tod in einem Buch so nahe – und doch soweit - entfernt – erlebt. Da drängt sich der Untergang des französischen Kaiserreichs – als Tod – und nicht als geschichtliches Ereignis – ins Bewusstsein. Seuche, Leben, Krieg, aber auch Kultur, Prunk und Macht sind nur seine Kleider.
Bild rechts: Die Brüder Goncourt: Edmond (links) (1822-1896) und Jules (rechts)
(1830-1870) (Foto: Wikipedia)

Alan Bennett
2008, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin (deutsche Ausgabe), 115 Seiten, ISBN: 978-3-8031-1254-5, 7. Auflage, aus dem Englischen von Ingo Herzke. Original: 2007, Forelake Ltd.
Leicht, fröhlich, verführerisch, verschmitzt und verdammt hintergründig – ein kleines Juwel, ein Kleinod, eine Kostbarkeit. Nein, kein Edelstein, ein Buch, ein Büchlein, mit wenig über 100
Seiten. Da ist einmal die Idee: eine Monarchin, keine erfundene, Elisabeth II., begegnet dem Buch, der Literatur. Gleichsam auf Nebenwegen, auf einem fiktiven Gartenausflug, mit ihren Hunden in
die hintersten Winkel des Palastes. Zwar ein undenkbares, aber theoretisch doch mögliches Fremdgehen Ihrer Majestät.

Hier trifft sie das Buch, besser: die Bücher, das Lesen, die Leidenschaft für das Lesen, das Glück des Lesens.
Literatur kann vieles ins Lot, aber ebenso viel in Unordnung bringen, ja ins Chaos stürzen. Sogar das Leben einer Königin, ihr Denken, ihre Pflichten, ihr Handeln. Besonders den Alltag im königlichen Käfig der Rituale und Pflichten.
Es ist nicht nur die Idee, die grossartig ist. Es ist auch das sprachliche Gewand: schlicht elegant, witzig und geschliffen, leichtfüssig und doch bedeutend. Zwar eine Übersetzung aus dem Englischen, in einem Sprachfluss, der dem hochnoblen Ort, dem prunkvollen Gespenst einer Monarchie, zwar würdig, aber nicht identisch ist.«Man liest zum Vergnügen», sagte die Queen. «Lesen ist eine Bürgerpflicht.» Punkt, kein Ausrufzeichen, einfach Punkt, auf den Punkt gebracht.

Eine Erkenntnis ihrer Majestät: «Literatur hatte etwas Erhabenes. Büchern war es egal, wer sie las oder ob sie überhaupt gelesen wurden. Vor ihnen waren alle Leser gleich, auch sie selbst…Erst
jetzt begriff sie, was Worte bedeuten. Bücher buckelten nicht.« Eine Ehrerbietung, eine Hommage, an das Wort, an das Buch, an die Schreibenden, nicht eine Attitüde gegenüber einer
Königin.
Idee, Sprache, Inhalt: wichtige Kriterien, um ein Buch zu lesen und auch zu loben. Doch es fehlt noch etwas, das nicht so leicht zu fassen ist: der Spass.

Der Spass, ein Vergnügen, beim Lesen. Dies nicht nur bei amüsanten, lustigen Büchern, auch bei ernsten, aufwühlenden, ja selbst traurigen.«Die
Lesefähigkeit der Jugend,» als Vermächtnis für die Zukunft. Ein hübscher Gedanke, ein aktueller vor allem. Dass, so nebenbei, auch das Wissen um Literatur geprüft wird, kommt im Zeitalter der
Quiz-Euphorie nicht schlecht an. Wenn auch – das ist der Nachteil von Sprachbarrieren – nur ein kleiner Teil der zitierten Literaturjuwelen, zum Wissensschatz gehören. Da dringt das Buch schon
ziemlich stark in die «Eingeweide» der englischen Literatur ein. Abrufbar nur ein kleiner Teil. Zumindest bei mir. Doch auch das ist – unter der königlichen Schirmherrschaft – eine Entdeckung,
und
damit ein echtes Vergnügen.
Peter Züllig

Gelesen:
Thomas Hürlimann
"Der Rote Diamant"
Roman
2022, Fischer Verlag Frankfurt a.M.
317 Seiten, ISBN 978-3-10-397071-5
Was wird nicht alles herbeizitiert, um Thomas Hürlimanns neuesten Roman zu deuten: Thomas Bernard, Umberto Eco, Robert Musil, Hermann Hesse, Dan Brown, natürlich auch Figuren – Schüler und Lehrer - rund um Harry Potter, darunter natürlich auch Lord Voldemort. Ich hasse solche literarischen Abgrenzungen, Vergleiche und Zuordnungen. Literarisches Hochgebet, kaum hilfreicher als eine Religion, wie sie im Roman als stockkonservativer Katholizismus gegeisselt wird. Ich erinnere mich an meine eigene Internatszeit – zehn Jahre früher als der Autor – in einer anderen Schule, weit höher gelegen als Hürlimanns Stift «Maria zum Schnee».

Man könnte immer und immer wieder lachen, sich mokieren, amüsieren, wenn der Kern der Erzählung nicht so bitter wäre. Die Darstellung einer in sich geschlossene Welt. Die wird, bei aller Kuriosität, immer bedrückender, immer auswegloser, von Traditionen, Ritualen, Symbolen erstickt. Der Roman löst sich von dem Schul- und Klosterleben, vom historischen Fundament (Untergang der Habsburger-Monarchie) und dem Zeitgeschehen.
Was da an Menschlichem auftaucht, wird seziert, entrückt ins Symbolische, ins Mysteriöse, ins Absurde. Vieles, vielleicht sogar alles, wird rasch und gründlich zum Symbol:

Die Schwarze Madonna in ihrem Festtagskleid; die stenzige junge Frau mit ihrer Zahnlücke (in der Arthur später seine Unschuld verliert); Mimi, «Arthis» Mutter, die mit ihren Stöckelschuhen
Spuren hinterlässt, wie die greise Kaiserin Zita mit ihrem Gehstock; «Herr Drossel», pfeifender Vogelmann, der als Bruder Pförtner die Klosterfestung bewacht; Bruder Frieder, früher Metzger,
abgehärtet im Krieg (Stalingrad), jetzt Herrscher im Internat; die Zöglinge: Viper, Primus Lenin, Ultimus Nebel, Clown Giovanni, der Kluge… Ein seltsamer Zoo von Menschen, die immer wieder auf-
und abtreten, zusammengehalten, ja zusammengefügt, durch die fliessende, klingende, präzise, die Fantasie anregende Sprache.

Sobald weder die gepflegte Sprache noch die Logik der Geschichte den «Zoo» bändigen und die vielen Stränge zusammenhalten können, wird zur Erinnerung gegriffen. Erinnerung an bereits Erzähltes
(im Buch, auch in weiten Werken von Hürlimann), an historische Personen und Ereignissen, an klassischem Bildungsgut, an Lehren und Heilslehren. Da werden Zeiten – weit auseinander liegend –
miteinander verbunden, da Winkel im «Gefängnis Steinstadt» mühsam erklettert, da wird geflüchtet bis in Fieberträume im Lazarett. Es ist der rote Diamant, verbunden mit der Madonna, der immer
stärker die Richtung vorgibt, den Plot bestimmt.

Da war ich Zögling 155 – zwar auf jedem Kleidungsstück festgehalten – doch im Internatsleben (ausser in der Wäscherei) ohne jede Bedeutung. Anders in der «Erziehungsanstalt Maria zum Schnee», wo Zöglinge mit Nummern bezeichnet, eingeteilt und angesprochen werden. Dieses Beispiel zeigt, wie stark der Autor die Welt überspitzt darstellt, zuweilen karikiert und sogar veräppelt. Nicht nur das Internat, in der abgeschirmten «Steinstadt». Überall, wo sich der Ich-Erzähler, der getriebene Held, Arthur Goldau, aufhält, bewegt und in immer wieder neue Abenteuer stolpert. Das ist gut so, den der Roman lebt – bei aller Faktennähe – von der Überzeichnung der Figuren und Situationen, vom Trimmen der Umstände, Zeiten und Realitäten ins Surreale und Komische.

Der geheimnisvolle, der kostbare, wohl auch der Wunder wirkende Stein. Er schafft genügend Gelegenheiten, über den Sinn des Lebens, des menschlichen Strebens, über den Wert der Dinge, die
Vergänglichkeit und den Tod nachzudenken, beflügelt von Fragen und Erkenntnissen der Philosophen, wie sie an Bildungsstätten wie dem Kloster «Maria zum Schnee» gelehrt wurden, bis Bob Dylan – zur
Zeit, als Arthur Goldau im Internat war – mit «The Times They Are a-Changing» das Morbide weggefegt hat und der «rote Diamant» ausgezogen ist. Weg aus dem sakralen Ort, in die individuelle Welt
des Privaten hinaus.



 SAMMLERFREAK
SAMMLERFREAK